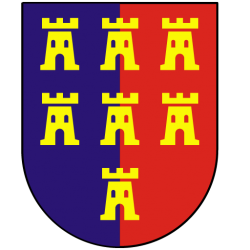INHALT
1. Die Hartenecktürme

Die Stadtmauertürme wurden von der Stadtgemeinde errichtet. Sie mussten im Verteidigungsfall von den Handwerkszünften besetzt und außerdem instandgehalten werden.
![Aquarellzeichnung der Harteneckgasse mit Fußgängern und einer Pferdekutsche | Quelle: Johannn Böbel 1885 [Public Domain]](https://7buergen.eu/wp-content/uploads/2019/03/4-47-1-Hartenecktuerme_1885-743x1024.jpg)
Der dritte Ringmauergürtel wurde von etwa 1325 bis 1375 errichtet und sollte gegen 1872 auf Befehl der Kommunität abgerissen werden. Dank eines Einspruchs des Stadthistorikers Emil Siberus wurden diese drei Türme verschont und die Gasse an den drei Türmen in Harteneckgasse umbenannt.
1.1 Der Zimmermannsturm

Der auf zylindrischen Unterbau mit der Wehrmauer verbundene Turm trug ursprünglich eine Wehrplatte mit Zinnenbrüstung. Er wurde zur Verbesserung der Verteidigungstechnik gegen verbesserte Geschütztechnik durch einen achteckigen auskragenden Oberbau ergänzt. Dieser Oberbau hatte auf der Stadtseite einen Zugang durch den halboffenen Wehrgang auf der Stadtmauer.

Die beiden obigen langen Schlitze im Mauerwerk dienten zur Verteidigung durch die Bogen- und Armbrustschützen.
Die dazwischen liegenden Schlüsselloch-Schießscharten wurden von Schützen mit Feuerwaffen besetzt.
Diese beiden todbringenden Verteidigungseinrichtungen wurden mit einem Reliefdekor getarnt, um den Feind zu täuschen.
Unterhalb des Schlüssellochs befindet sich für den Nahkampf das kreisrunde Gussloch, um die Angreifer mit siedenden Wasser, Pech und Fett zu vertreiben.
1.2 Der Töpferturm

Der Turm mit rechteckigem Grundriss wurde erst nachträglich quer über die bereits vorhandene Stadtmauer gestellt, so dass die Längseiten quer zur Stadtmauer verlaufen.
In etwa der halben Höhe verjüngt sich das Mauerwerk, um dann über Konsolträger nach aussen zu kragen. In der Auskragung befinden sich die Gusslöcher.
Unter der Traufe des Pyramidendaches mit seinen elegant geschwungenen Graten, sind die Schießschlitze durch abgetreppte Ziegel verziert und gleichzeitig getarnt.
1.3 Der Armbrusterturm

Der Turm entstand zugleich mit dem Zimmermannsturm und der Stadtmauer und war mit dieser verwachsen. Allerdings steht der Turm heutzutage einzeln und frei ohne Stadtmauer da.
2. Der Namensgeber der Gasse: Sachs von Harteneck (Johann Zabanius)
- 1664 wird Johann Zabanius als Sohn des Isak Zabanius im Ort Eperiesch in Oberungarn (heute Prêsov in der Slowakei) geboren. Der Vater ist Konrektor des Gymnasiums.
- 1670 muss die Familie wegen der Protestantenverfolgung nach Siebenbürgen auswandern.
- 1688 erhält Johann Zabanius den akademischen Grad des Magisters der Weltweisheit, nach dem Besuch von Schulen in Hermannstadt und Weißenburg sowie dem Studium in Tübingen.
- 1690 Johann Zabanius wird als Provinzialnotarius in Hermannstadt angestellt und heiratet am 26. April Elisabeth Haupt, die Tochter des 1686 verstorbenen Königsrichters Johann Haupt.
- 1692 Der Vater Isak Zabanius wird zum Stadtpfarrer von Hermannstadt gewählt.
- 1693 Die sächsische Nationalversammlung wählt Johann Zabanius zum Mitglied der siebenbürgischen Verhandlungsdelegation am Wiener Hof.
Die Verhandlungen am Wiener Hof erwirken die Bestätigung der sächsischen Nation durch das Leopoldinische Diplom, als Rechtsbasis für ihren ständischen Fortbestand. Damit wird auch die rechtstaatliche Lage Siebenbürgens als habsburgische Provinz geklärt. - 1697 Johann Zabanius wird durch die sächsische Nationalversammlung zum Königsrichter von Hermannstadt und zum Sachsengrafen gewählt.
- 1698 Kaiser Leopold I. von Österreich ernennt Johann Zabanius zum Ritter des heiligen Römischen Reiches mit dem Ehrentitel Sachs von Harteneck.
- 1699 Nach dem Widerspruch eines Teils des ungarischen Adels wird Harteneck mit einer Probezeit von einem Jahr zum Sachsengraf ernannt.
- 1702 Harteneck fordert auf den Landtagen für alle Staatsbürger gleiche Abgabepflichten, nach Einkommen aus Besitz und Arbeit. Bislang genießt der ungarische Adel Steuerfreiheit und die niederen Stände, sowie die Sachsen leiden unter den erdrückenden Steuerlasten.
Der Gegensatz zwischen dem ungarischen Hofkanzler Miklós Bethlen (Haupt der Calvinisten) und dem Sachsengraf Harteneck tritt deutlich hervor und der ungarische Adel sucht nach Möglichkeiten Harteneck auszuschalten. - 13. 02. 1702 Kaiser Leopold unterzeichnet die Urkunde, welche Harteneck zum Grafen der sächsischen Nation und zum Königsrichter von Hermannstadt auf Lebenszeit im Amt bestätigt.
- 28. 09. 1703 Der Schäßburger Bürgermeister Johann Schuller von Rosenthal wird wegen Erpressung, Veruntreuung öffentlicher Gelder, Münzfälschung und Betrugs zum Tode verurteilt und am 28. September hingerichtet. Johann Schuller war im Osmanischen Reich erzogen worden und ein Günstling des Sultans. Der Reichtum von Johann Schuller war grenzenlos.
Durch diesen Fall erwuchs Johann Sachs von Harteneck auch Feinde aus dem sächsischen Beamtenadel. - 14. 10. 1703 Harteneck wird in Hermannstadt verhaftet und im Kerker des Schlosses Fogarasch inhaftiert.
- 26. 10. 1703 Der Gubanator (Gouverneur) Graf György Bánffy von Losoncz I. verkündet den Beschluss der Landesregierung gegen Harteneck Anklage auf Hochverat zu erheben. Die Anklage soll vom Direktor für königliche Rechtssachen vor die Stände des Landes gebracht werden.
- 31. 10. 1703 Harteneck wird nach den Regeln des ungarischen Gerichtsverfahrens die Anklage mitgeteilt.
- Er habe die Begnadigung des Schäßburger Bürgermeisters Johann Schuller durch den Kaiser mit Füßen getreten (die Begnadigung galt aber nur für das Delikt der Falschmünzerei).
- Er habe bevorzugt auf den Landtagen eine Spaltung der Stände und Nationen erzeugt.
- Er habe dem Kaiser Ratschläge erteilt, welche die Staatsverfassung untergraben.
- Er habe geheime Beschlüse des Guberniums verraten.
- Er habe ohne Wissen und Zustimmung der sächsischen Nation gehandelt.
- Er habe schuldlose Leute verschiedener Verbrechen angeklagt und auch Mörder gedungen, um diese oder jene Persönlichkeit zu verfolgen.
- 26. 11. 1703 Der nach Hermannstadt einberufene Landtag versammelt sich als Staatsgerichtshof.
- 03. 12. 1703 Der Angeklagte wird vom Landtag für das Verbrechen des Hochverrats für schuldig erkannt, zum Tode verurteilt und seine beweglichen sowie unbeweglichen Güter werden eingezogen. Eine Berufung ist unzulässig.
- 03. 12. 1703 Am gleichen Tag schreitet auch der Gerichtshof des Hermannstädter Rates zur Urteilsverkündigung.
Was war passiert?
Hartenecks Frau Elisabeth hat ihren Kammerdiener Hans Adam angestiftet, ihren Ex-Geliebten den kaiserlichen Generaladjudanten von Acton zu vergiften. Als der Anschlag mißlang, flüchtete der Diener in Hartenecks Haus (Sporergasse Nr. 4 ) und wird zunächst versteckt und dann vom gedungenen MörderJohann Pap umgebracht. Die Leiche wird vom Gärtner Michel Lorenz im Hausgarten des Fileckhauses in der Sporergasse Nr. 4 verscharrt. Nach einem Jahr wird der Leichnam ausgegraben, in ein leeres Faß gesteckt und zum Elisabethtor hinaus gefahren und in den Fluss Alt (Olt) geworfen. Hartenecks Frau hat mit diesem Mord den unliebsamen Zeugen des ersten Mordversuchs beseitigen lassen. Harteneck, der davon erst später erfährt, zeigt seine Frau nicht an, um sie zu schützen. - 05. 12. 1703 Harteneck schreitet mit großer Ruhe zur Hinrichtung am Großen Ring. Das Todesurteil wird um 15:00 Uhr vollstreckt.
- 20. 02. 1704 Die Urheberin des Verbrechens, Elisabeth von Harteneck, wird durch einen Ablassungsbeschluss des Hermannstädter Rates straflos gestellt, erhält aber Hausarrest, welcher im Juni 1705 aufgehoben wird. Der gedungene Mörder des Kammerdieners wird begnadigt. Das Vermögen der Eheleute Harteneck wird konfisziert.
Obwohl die persönliche Schuld Hartenecks durch seine Mitwisserschaft nicht zu leugnen ist, so kann man doch durch die willkürlichen Todesurteile von einem politischen Mord sprechen, um damit einen politischen Gegner auszuschalten, welcher für die Steuergerechtigkeit und gegen die Korruption kämpfte. Die eigentlichen Anstifter und Täter wurden begnadigt. - 1704 Veröffentlichte der siebenbürgische Kanzler Miklós Bethlen unter Pseudonym eine Flugschrift, in welcher er einen Plan zur Wiederherstellung der siebenbürgischen Unabhängigkeit unter einem deutschen protestantischen Fürsten entwickelte. Der österreichische militärische Kommandant von Siebenbürgen Johann Ludwig von Rabutin-Bussy liess daraufhin den Kanzler Bethlen wegen Hochverrat verhaften. Er saß in Hermannstadt, Esseg und Wien bis an sein Lebensende 1716 In Haft und schrieb dort seine Memoiren.
- Die Witwe Elisabeth von Harteneck tritt zum katholischen Glauben über und heiratet den kaiserlichen Major Johann Michael Freiherr von Möringer und erhält ihr konfisziertes Vermögen zurück, welches sie von ihrem Vater geerbt hatte. Zum Erbe gehörte auch das Haus in der Sporergasse (Strada General Magheru ) Nr. 4.
- 1757 stirbt die Baronin Elisabeth von Möringer.
3. Textquellen
- Ferdinand Zieglauer von Blumenthal, „Sachs von Harteneck, Johann“ in: Allgemeine Deutsche Biographie 30 (1890), S. 134-142
- Juliana Fabritius-Dancu, Spaziergang durch Alt-Hermannstadt, Nr. 47, Die Harteneckgasse, Sibiu 1983
- István Torjai-Szabó, Bethlen von Bethlen, Miklós Graf, in: Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Bd. 1. Hrg. Mathias Bernath / Felix von Schroeder. München 1974, S. 199-200